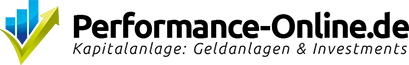Für eine erfolgreiche Geldanlage ist es wichtig, die infrage kommenden Anlageprodukte zu verstehen …
Gewinn
erwirtschaftenmw-headline" id= "Allgemeines" id="Allgemeines" id="Allgemeines="mw-editsection-bracket">[Bearbeiten | | | Quellcode bearbeiten]>
In der Wirtschaft ist der Gewinn oder das Resultat der Gewinn oder das Resultat der Gewinn über die Ausgaben eines Firmen. Der negative Gewinn bedeutet Verluste. In der Rechnungslegung ist die Definition von Gewinn weitestgehend unbestritten. Durch den erwirtschafteten Gewinn wird die Gewinnabsicht der Händler realisiert. Für die Berechnung des Ergebnisses schreibt das Gesetz vor, dass der Unternehmer am Ende des Geschäftsjahrs (Bilanzstichtag) die Ausgaben und Einnahmen in einer Gewinn- und Verlustbilanz zu vergleichen hat (§ 242 Abs. 2 HGB).
Aus dem Gewinn ging der Name der Gewinn- und Verlustbilanz hervor. Mathematisch gesehen führt dieser Vergleich zu einem Gewinn, wenn die Ausgaben geringer sind als die Einnahmen: Ansonsten gibt es einen Verlust: Konzeptionell ist die Gewinnverwendung vom Gewinn als solchem zu trennen, was im jeweiligen Sprachverstehen zum Ausdruck kommt. In der Ideologie der DDR bezog sich der Gewinn auf die Überschusseinnahmen in sozialen Unternehmungen, während er in Kapitalismusunternehmen auch als Gewinn bezeichnet wurde[15] und mit der Assoziation "ausbeuterisch, geldgierig" assoziiert wurde.
16 ] Aktivitäten, mit denen man "Gewinn machen" (="Gewinn machen") kann, werden als "lukrativ" bezeichne. Dies liegt am lateinischen Begriff Lukrum (Gewinn, Vorteil). Im deutschen Gesellschaftsrecht wird beispielsweise zwischen den Bezeichnungen Gewinn und Jahresüberschuss unterschieden. Das Ergebnis nach Ertragsteuern wird häufig auch als Ergebnis nach Ertragsteuern bezeichne. In der Marktwirtschaftstheorie ist das Gewinnstreben (ökonomisches Prinzip) ein essentielles Charakteristikum des Unternehmens.
Durch das Streben nach Gewinn wird der Unternehmen dazu angeregt, die Wünsche potenzieller Käufer zu kennen und zu erfüllen und sich an veränderte Marktbedingungen in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu gewöhnen. Nichtfreie Wirtschaftssysteme (zentralisierte Verwaltung) ersetzen das Profitstreben durch das Konzept der planmäßigen Erfüllung (daher der umgangssprachliche Begriff "Plan- oder Kommandowirtschaft"). Es gibt keine Koordinierung der einzelnen Wirtschaftspläne über den Mechanismus des Marktes, sondern die Koordinierung erfolgt über einen Zentralplan.
Gewinn ist der Teil der Wertsteigerung, den die Eigentümer (Aktionäre) des Konzerns als Ertrag oder Vermögenszuwachs erwirtschaften. In der Betriebswirtschaft wird der Ausdruck Erfolg als Sammelbegriff für alle verschiedenen (konkreten) Ertragskonzepte vorgezogen. Der Gewinn wird in den als Gewinn- und Verlustrechnung bekannten Buchhaltungssystemen ermittelt.
Abhängig von der Zielsetzung und Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich der spezifische Gehalt des jeweiligen Erfolgskonzepts. Der Begriff des Gewinns wird dagegen erst durch die Bestimmungsregeln der Gewinn- und Verlustrechnung greifbar (messbar) gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Periode dient der Bestimmung des Ergebnisses einer Geschäftsperiode (z.B. Geschäftsjahr), der Ergebnisbeitrag einer individuellen Produkt-Einheit oder eines Einzelauftrages wird in der Stück-Gewinn- und Verlustrechnung errechnet.
Das zentrale Problemfeld der periodischen Erfolgsrechnung ist die Zuordnung der Erfolgskomponenten positiv (Ertrag oder Ertrag) und negativ (Aufwand oder Aufwand) zum jeweiligen Betrachtungszeitraum. Der Gewinn als Geschäftsindikator ist zunächst von untergeordneter Bedeutung, solange nicht auf andere Variablen, wie z.B. die zur Gewinnerzielung verwendete Kapitalmenge, verwiesen wird.
Der Aussagewert wird auch dadurch gemindert, dass der Bilanzgewinn (formal als Jahresüberschuss gemäß 275 Abs. 2 Nr. 20 HGB bezeichnet) in der Regel nicht das tatsächliche Geschäftsergebnis widerspiegelt, weil die gesetzlichen Vorschriften und die Bilanzierungspolitik dies schwieriger machen oder vermeiden (siehe Rückstellungen, Niederstwertprinzip, versteckte Reserven). Im Rahmen der Kostenrechnung ist das Betriebsergebnis die Summe aus Erträgen bzw. Tätigkeiten und Aufwendungen; die KLR wird in erster Line dazu verwendet, interne Informationen für die kurzzeitige (operative) Planungen von Aufwendungen und Erträgen bereitzustellen und diese über Plan-, Soll- und Ist-Daten zu steuern (siehe auch Controlling).
Bei einer längerfristigen und projektbezogenen Leistungserstellung - zum Beispiel im Bereich des Anlagenbaus - ist es jedoch oft schwer, Erträge und Kosten den Zeiträumen zuweisen. Weil die Ergebnisermittlung in der Fremdbilanzierung zum Gläubigerschutz, zur Unterrichtung der Aktionäre, zur Ermittlung des ausschüttbaren Bilanzgewinns und zur Bestimmung der steuerlichen Bemessungsgrundlage nicht im Ermessen der Gesellschaften steht, bestehen entsprechende Detailregelungen, die sich im hiesigen Recht, vor allem im HGB und in den steuerlichen Gesetzen wiederfinden.
Nach § 242 Abs. 2 HGB ist die Gewinn- und Verlustrechnung ein Vergleich der Ausgaben und Einnahmen des Geschäftsjahrs. Der Begriff des Aufwands und Ertrags bezieht sich daher immer auf den handelsrechtlich relevanten Gewinn oder Verlust und kann nur auf diese Weise in der Geschäftsterminologie verwendet werden. Der Gewinn ist die Differenz zwischen dem Geschäftsvermögen am Ende des Wirtschaftsjahrs und dem Geschäftsvermögen am Ende des vorhergehenden Wirtschaftsjahrs, erhöht um den Betrag der Entnahme und reduziert um den der Einlage.
Es wird zwischen folgenden Arten der Ergebnisermittlung unterschieden: Ergebnisermittlung nach Durchschnittskursen nach § 13a (3-6) EStG. Gewinnberechnung für Unternehmen mit Frachtschiffen im grenzüberschreitenden Güterverkehr nach der in der Gesellschaft verwalteten Menge nach § 5a EStG. Ist es den Steuerbehörden nicht möglich, die Steuerbemessungsgrundlagen zu ermitteln oder zu berechnen, müssen sie die Steuerbemessungsgrundlagen nach § 162 Abs. 1 Nr. 1 AO errechnen.
Die Ergebnisse dieser Abschätzung werden dann als Gewinn einer der Arten der Gewinnermittlung gemäß 4 bis 5a StG betrachtet. Weil gerade große Unternehmen verstärkt nach international em Standard, nämlich US-GAAP oder International Financial Reporting Standard (IFRS) kalkulieren, werden immer öfter auch die korrespondierenden anglo-sächsischen Gewinnbedingungen herangezogen.
Nach angelsächsischem Standard ermittelte Erträge unterscheiden sich vom kommerziellen Gewinn, da diese Regeln und Vorschriften auf unterschiedlichen Überlieferungen und Umständen beruhen. Um Missverständnisse zu vermeiden, spricht die interne Rechnungslegung nicht vom Gewinn, sondern vom operativen Ergebnis. Als operatives Ergebnis wird die Summe aus Leistung und Aufwand errechnet. In der Berechnung und damit eventuell auch in der Summe unterscheiden sich Aufwand und Ertrag von den korrespondierenden Ausgaben und Einnahmen des gleichen Unternehmens.
Handelt es sich bei den Ausgaben nicht um Ausgaben, gelten sie als nicht operative Aufwände. Differenzen zwischen Ausgaben und Ausgaben werden als rechnerische Ausgaben betrachtet. Der Gewinn des Unternehmens (aller Systeme) wird durch fremde Vorschriften verfälscht, so dass er für Kontrollzwecke als nicht ausreichend erachtet wird. Das Beratungsunternehmen "Stern und Stewart" hat deshalb ein Alternativkonzept erarbeitet, das auf Angaben aus der Fremdbuchhaltung nach internationalem Standard basiert, diese aber betriebswirtschaftlich ausgleicht.
Das so berichtigte Ergebnis heißt NOPAT (Net Operational Result nach Steuern). Demnach ist eine Wertentwicklung jedoch nicht allein mit einem guten NOPAT assoziiert; erst wenn die Kapitaleinsatzkosten erwirtschaftet sind, führt ein Überschuss der Periode (Übergewinn) zur Unternehmenswertsteigerung. Dieser Unterschied zwischen NOPAT und den Eigenkapitalkosten wird als Economic Value Added (EVA) bezeichnet. 2.
Der EVA trägt vielen der Anpassungen Rechnung, die auch die Differenz zwischen den Ergebnisgrößen der Innen- und Außenrechnung der Periode wiedergeben. Allerdings wird die Gewinn- und Verlust-Rechnung nicht - wie zu erwarten wäre - mit einem Gewinn/Verlust abgeschlossen, sondern mit einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag. Das Ergebnis ist jedoch nicht immer mit dem Jahresergebnis gleichzusetzen.
Dies gilt vor allem dann, wenn die bilanzielle Gesellschaft ihren Jahresüberschuß als Tochter an die Konzernmutter abzuführen hat oder von ihr einen Jahresfehlbetrag erhält. Der Ausweis dieser Gewinne oder Verluste aus Ergebnisabführungsverträgen ist in einer Bilanzposition vor dem Jahresüberschuss/-fehlbetrag irreführend ( 277 Abs. 3 HGB),[17] führt jedoch in keiner Weise zu einer betriebswirtschaftlich richtigen Ergebnisdarstellung bei der Konzerngesellschaft.
Ergebnisabführungsverträge stellen in der Regel sicher, dass der bilanzielle Gewinn "Null" ist. Tatsächlich hat das Untenehmen jedoch Gewinne/Verluste erzielt, die von der Konzernmutter ausgeschöpft oder aufgerechnet wurden. Dies erfolgt über "Aufwendungen aus Gewinnabführung" und "Erträge aus Verlustübernahmen", die gemäß 277 Abs. 3 S. 2 HGB separat ausweisen sind.
Diese stellen den Ausgleichsposten für die tatsächlichen Gewinne/Verluste dar. Möxter, A.: Meaning and Methodology of Business Profit Determination, in: Business Administration, 36th Ed., 1983, S. 133-134th Chmielewicz, Klaus: Accounting, Volume 2: Pr. pagatoric and calculative income statement, 4th ed. Eugen Schmalenbach: Grundlagen dynamischischer Bilanzlehre, 1919, p. 6. Karl Hax: Der Gewinnbegriff für der betrieblichen wirtschaftslehre, ZfhF Nr. 6. Ergänzungsband, 1826. Fritz Schmidt: Die organischer Tagewertbilanz, 1929, p. 244 ff.