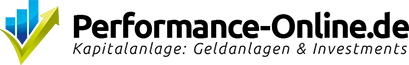Geht es um die Sicherheit bei der Geldanlage, haben Rentenfonds seit langem einen guten Ruf. Das …
Suche Haus zum Kaufen von Privat
Haus suchen, um privat zu kaufenPlanung, Kauf und Bau Ihres Eigenheims in 10 Schritten: Vom Suchen bis zum.... - Der Stimpel
Ein Haus zu kaufen oder zu bauen ist eines der grössten Projekte im ganzen Jahr. Viele die diesen Wunsch in Ehren halten, empfinden die Hinrichtung vorerst als überwältigend. Hinweise zur Suche, Finanzierbarkeit und staatlichen Unterstützung, zu Gesprächen mit Kreditinstituten, Bauunternehmen, Architekten und Notaren ermöglichen es auch unerfahrenen Bauträgern, fundierte Entscheidungen zu treffen und vernünftig zu disponieren.
Von der Lust am eigenen Zuhause bis zum Umzug Management leistet dieser Berater bereits in der zweiten, überarbeiteten Ausgabe Hilfestellung - schrittweise.
Auf der Suche nach dem unendlichen Sein - Robin Gates
Auf den zweiten Blick erweist es sich als Schaufenster zu einem Zauberort. Zusammen mit seiner Schülerin Annika verstrickt sich der Historiker in eine alte Konfrontation: Der heimliche Dilmun-Garten wird seit Tausenden von Jahren von Fabelwesen beschützt. Doch ihre ausgestoßenen Angehörigen versuchen, die Macht über diesen zauberhaften Platz zu erlangen.
Doch sie sind nicht die Einzige, die behaupten, daß es ihn gibt. Auf der wilden Suche nach dem Paradiesschlüssel.... Die E-Books von beBEYOND - Fremdwelten und phantastische Reise.
Spanne id="Sprache_Pr.C3. php?title=Swiss English&veaction=edit§ion=1" title="Abschnitt editieren: Sprachliche Klärung des Begriffs">edit&action=edit§ion=1" title="Edit section: Sprachliche Genauigkeit des Begriffs">Quelltext bearbeiten]>
Schwyzerdeutsch (Schweizerdeutsch, Schwyzerdeutsch, Schweizdeutsch und Ähnliches, Französisch-Schweizerisch, Italienisches Svizzero Tedesko, Rätoromanisches Tudestg svizzer) ist ein Sammelbegriff für die in der Deutschschweiz von allen sozialen Schichten verbreiteten Alemannen. Das Standarddeutsch in der Schweiz heißt Swiss High German (in der Schweiz: High German oder Schriftdeutsch) und ist nicht dasselbe wie das Schweizerdeutsche.
Der deutsch-alemannische Dialektbestand in der Schweiz umfasst Hunderte von deutsch-schweizerischen Dialekten. Jahrhundert haben zu sehr unterschiedlichen lokalen Dialekten und damit auch zu Kommunikationsproblemen zwischen den deutschsprachigen Schweizern gefÃ?hrt.
Schweizerdeutsche aus dem "Unterland" beispielsweise haben es oft schwer, die meisten Alemannendialekte - wie das Walliser Deutsch - zu deuten. Der Aufbau der schweizerisch-deutschen Dialektindikatoren entspricht dem der alamannischen (westoberdeutschen) Dialektcharakteristik. Die holländische Mundartgruppe in der Schweiz umfasst den Mundart Basel-Stadt, Basel-Deutsch. Die Niederalemannik (im weiteren Sinne) wird sowohl im Norden des Bodens als auch in dem Teil des früheren Bundeslandes Baden (im jetzigen Baden-Württemberg) im Süden der Ostsee, dem Fluss durch Baden-Baden, ausgesprochen.
Zum Niederalemannisch gehört auch eine Vielzahl elsässischer Mundarten. In der Schweiz werden die meisten Hoch-Alemannischen Sprachen verwendet. Die Mundarten des äußersten Südwestens Baden-Württembergs und des Schlesischen Sundgau gehörten dann zum Hohen Alemannischen. Die Zugehörigkeit der Mundarten des Südvorarlbergs und des Landes Liechtenstein zum Hochallemannischen oder Mittleren Allemannischen (Bodensee-Allemannischen) ist abhängig von den entsprechenden Dialektklassifizierungskriterien.
Eine besonders zurückhaltende Gruppe sind die Walliser und Walser -Siedlungen (Piemont, Kanton Basel, Liechtenstein, Vorarlberg), das bernische Oberland und Schwarzenburgerland, die Bündner Kantone Freiburg und Jaun, die südliche Zentralschweiz (Uri, die Walliser und die vom Walser in Nord-Italien und Kanton Bern gegründete Tochtergemeinde).
Der Unterschied zwischen den deutsch-schweizerischen Dialekten ist verhältnismässig gross. Um es ganz offen zu sagen, fast jede Gegend und manchmal auch jede Kommune hat ihre eigenen lokalen Besonderheiten in ihrem Mund. Einige deutschsprachige Schweizern können allein aufgrund ihres Dialekts einer Heimatregion zugeordnet werden. 3] Trotz der Differenzen sind die Schweizerinnen und Schweizer an die unterschiedlichen Mundarten wie Hörfunk und TV gewöhnt und verstanden.
Im Volksmund werden die Mundarten nach den einzelnen Bezirken aufgeteilt; man unterscheide zwischen Baslerdeutsch, Deutsch für Anfänger, Deutsch für Anfänger, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Anfänger, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Fortgeschrittene, Deutsch für Fortgeschrittene. Trotz seiner geografischen Position zählt der Graubündner Walser-Deutsche nicht zum Südosten, sondern zum Südwesten der Schweiz, da diese Mundarten auf das Südwestschweizerdeutsch des Wallis zurueckgehen. Insgesamt sind diese vier Metropolen aber auch oft unterteilt, und die zwischen den oben erwähnten Pole liegenden Mundarten in den Kanton Zürich, Luzern, Kanton und Chur Rheintal können ihnen nur eingeschränkt zugeordnet werden.
Das Zürcher Deutsch zählt z.B. zum Nordostschweizerdeutsch im Hinblick auf den Schnittpunkt von "primary rumlaut or verbal unit plural" und "Hiatdiphthongierung", nicht aber im Hinblick auf die Entstehung der mittel-hochdeutschen Diphthongesänge und der sogenannten deutschen ë, die als[äi],[au],[æ] wie in den weiter im Westen verbreiteten Dialekten realisiere. Die innere Struktur des Schweizerdeutsch wird klarer, wenn man dialektale Eigenschaften kombiniert.
Die aus dieser Integration der Einwohner resultierende Mundart wird im Volksmund als "Bahnhofbuffet-Oltener Dialekt" umschrieben, wodurch die jeweiligen regionalen Wurzeln erklingen. Doch auch die ländlichen Sprachen werden von den neuen Dialekten der Metropolen stark unter Beschuss genommen. In den meisten Dialekten der Schweiz sind die Eigenschaften der Monophthongiation und Diphthongiation des Neuen Hochdeutschen nicht vorhanden. Ähnlich wie in Mittelhochdeutsch: Huus[hu?z?] ist "Haus", Züüg[t?sy???] ist "Zeug", wiit[?i?t] ist "weit" etc.
Ein weiterer Ausnahmefall bezieht sich auf die Hiat-Diphthongiation der langen Vokale vor Vokalen, die im nieder- und höheralemannischen Dialekt vorkommt, nicht aber im alemannischen: (Beispiele): Die mittel-hochdeutschen Eröffnungsdiphthonge d. h., u, Üe korrespondieren in der Standard-Sprache des Monophthonges (vgl. dazu die Literatur, wo sie noch in der Handschrift konserviert ist, aber dennoch spricht [i?]), diese Dialekte sind in den deutsch-schweizerischen Sprachen beibehalten.
Gleiches gilt: Eine geschriebene ue wird nicht ü gesprochen, sondern ú-e[u?] (mit Schwerpunkt auf dem -ú-), also ist der schweizerische "Rudolf" Ru-edi[?ru?d?i], nicht Ru-edi. Die lange a ist in vielen Dialekten sehr düster und neigt zu o, mit der sie auch in bestimmten Dialekten (vor allem in der Nordwestschweiz) übereinstimmen kann.
In Zürich ist ein weiteres dreigliedriges Sprachsystem bekannt: Wie die West- und Zentralschweizer Dialekte hat es das germanische ë von[?] auf[æ] herabgesetzt, aber nicht vor /r/, z.B. ässe[æs??] "essen", sondern stèèrbe[?t??rb?] "sterben", und der Umlaute von ahd. /a:/ ist auch[??], z.B. èèr[l??r] "leer".
Die hochdeutschen Konsonantenverschiebungen haben viele deutsch-schweizerische Mundarten komplett ausgeführt; ein germanisches /k/ im Silbenklang korrespondiert mit einem[x] (wie in Chind, chalt), ein /kk/ im Silbenklang mit den Affrikaten[k?x] (wie in Stock[?tok?x], Sack[z?ak?x]). Diese sind jedoch nicht für alle schweizerisch-deutschen Mundarten charakteristisch, sondern für die Hoch-Alemannischen Mundarten; sie betreffen nicht die schweizerisch-deutschen Mundarten, die nicht hoch-Alemannisch sind, sondern auch die hoch-Alemannischen nicht.
In den meisten Mundarten wird ch immer samtweich gesprochen, in einigen immer vokal, auch nach Frontvokalen ("wichtig"[???xti??]). In den meisten Mundarten wird das r alveolär gesprochen (Zungenspitzen-R), in Baseldeutsch und einigen Gebieten der Westschweiz (Zäpfchen-R) jedoch uvulär. Bei vielen Mundarten in der Westschweiz mit dem Emmental als Mittelpunkt wird der Klonant l am Ende der Silbe oder in der Edelsteinbildung zu u (IPA: w) gesungen; dieses PhÃ?nomen ist vergleichsweise jÃ?nger und verbreitet sich derzeit: alle >[?aw?i], viel >[?v??w].
In den meisten Mundarten wird zwischen zwei Vokalen unterschieden: -i und -?, zum Beispiel in i(ch) ? ("I make", indicative) - i(ch) machi ("I make", subjunctive). Hochalemannische Mundarten wie das Wallisdeutsche haben manchmal eine noch differenziertere Sekundärsilbe, indem sie auch -a, -o und -u sowie closed -e unterscheiden: In den meisten schweizerischen Mundarten sind Einzahl und Mehrzahl der "Zunge" identische Zungen, wie es in einigen wallisischen Mundarten im nominativen singulären Zungas ( "Zunga"), im dativen singulären Zungu ("Zunga") heißt.
In den meisten Dialekten ("n-apokopes") fehlt ein abschließendes -n, besonders in der Schlussnote -en (chouffe - buy, Häagge - hook), aber auch nach gestressten Stammvokalen wie in Worten wie Wy - "wine" oder Maa - "man". Bestimmte Alpendialekte (vor allem Ostberner Oberland, Oberprättigau und Lötschental) führten die Napokope nicht durch.
Die konservativen Alpendialekte wissen diese nicht. Das Suffix -ung wird in den meisten Sprachen als -ig ausgesprochen (aber nicht im Wallis, in der traditionellen Stadt Bernisch sowie in Schaffhausen Deutsch und nur zum Teil in Sensler Deutsch). Auch im Schweizerdeutsch gibt es Vokabeln, die mit -ele. allwääg, äuä- Modalpartikeln "wohl" abschließen; in der Anwendung als Satzpartikel hat sich die ursprüngliche Ironie'wohl kaum' durchgesetzt; sie - bedeutet als Adjektiv/Adverb Verstärkung, kann je nach Mundart und Zusammenhang als gewöhnlicher Umgangssprachausdruck (besonders in der Jugendsprache) oder als Derberfluch aufgefasst werden.
Doch die meisten dieser Begriffe sind nicht nur für die Alemannen der Schweiz typisch, sondern auch für die Alemannen des südlichen Schwarzwaldes. Manche Begriffe des schweizerisch-deutschen Vokabulars finden ihren Weg ins gemeinsame Hochdeutsche, z.B. Müesli oder Pütsch, andere als sogenannte Hellseher in das Landeshochdeutsche (Schweizer Hochdeutsch).
In der Schweiz werden die Worte in unterschiedlicher Weise verwendet. Allen Dialekten im deutschsprachigen Raum ist eines gemeinsam: Es gibt keine einheitliche Schreibweise. Gleiches gilt für die schweizerisch-deutschen Mundart. Eher ist die Haltung, dass man den Mundart "nach Gefühl" oder "wie man sagt" schreibt, eine Haltung, nach der die Schreibweise zum Bereich des Hochdeutschen, nicht aber zum Mundart zählt, weitläufig.
Alle Beschriftungen in Schweizerdeutsch basieren im Großen und Ganzen auf den phonetischen und schriftlichen Zuordnungen der Standardform. In der alltäglichen Anwendung wird es auch für die Schwa[] verwendet; eine Anwendung, die nur in Dialektwörterbüchern und in der Mundartliteratur für alpine Sprachen zu finden ist, wo sie aus klanglicher Sicht besser geeignet ist. Er ist ohne Ausnahme für die Klangfolge[??], nie für[i:] zu haben.
In der Umfrage 2010 des Statistischen Bundesamtes lag der Bevölkerungsanteil der deutschsprachigen Schweiz bei 65,6%. Davon erklärten 93,3% in der Zählung von 2000, dass sie im täglichen Leben dialektisch sprachen. 66,4 Prozent der Befragten erklärten gar, dass sie nur Mundart und kein Hochdeutsch sprachen. Monolinguale Kanton, in denen Deutsch-Schweiz von der lokalen Bevoelkerung spricht:
Inzwischen sind auch die meisten rätoromanischen Schweizerdeutsche einflussreich. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Lage des Schweizerdeutsches weitgehend ähnlich wie die der anderen deutschsprachigen Dialekte: Diese Unterscheidung kommt linguistisch dadurch zum Ausdruck, dass die oft mit Deutschland verbundene Einheitssprache kaum als Lautsprache benutzt wird. In der Schweiz ist seit Ende der 1960er Jahre eine echte Dialektwelle (Dialekt = Schweizer Dialekt) zu verzeichnen.
Die in den 80er Jahren gegründeten Privatradios waren hier die Pioniere. Je laenger, desto mehr unterschiedliche regionale Mundarten sind auf Bundesebene zu hoeren. Mit dem Aufbau von neuen Verfahren, nämlich SMS, Instant Messaging, kollaborativen Netzwerken, Internet-Foren, Chatrooms und (privaten) E-Mails, die dem tatsächlichen Zweck der oralen oder quasi-oralen Verständigung dienten, aber die schriftliche Ausdrucksweise ("schriftliche Gespräche") nutzen, rückte auch das überwiegend nur mündlich verbreitete Schweizerdeutsche in den Bereich des Schriftsprachlichen vor und stärkte damit die Welle der Mündlichkeiten.
In Ermangelung weitreichender Normen benutzt jeder seine eigene Rechtschreibung; Kürzel, anglizistische Ausdrücke oder das in der Schweiz sonst ganz ungewöhnliche ß sind oft in SMS zu finden, um Zeichen zu speichern. Das Schweizerdeutsche hat vielfältige soziale Funktion. Das Schweizerdeutsche ist weder eine Trend- noch eine Fachsprache. Sie wird von allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen genutzt und ist im Gegensatz zu Dialekten in anderen Staaten nicht als eine " Unterklasse " diskret.
Obwohl alle Klassen Mundart sprechen, weicht der Mundart der Oberschicht signifikant von dem der Mittelklasse ab, die sich ihrerseits sowohl vom Mundart der Unterklasse als auch vom Mundart der ländlichen Bevölkerung abhebt. Die in der Schweiz verwendete Sprache trennt zwischen Mundart und Standard. Lediglich die Mundarten stellen ein kontinuierliches Ganzes dar, nicht die Standard-Sprache im Übergangsbereich zu den anderen.
Ein sprachliches Äußern kann nicht in einer mehr oder weniger dialektalen oder Standard-Sprache gemacht werden; man kann entweder dialektisch oder Standard-Sprache reden und zwischen beiden wechseln. In der Schweiz werden Mundarten von allen Gesellschaftsschichten im oralen Umfeld als Kommunikationssprache benutzt; das Reden von Dialekten ist daher nicht verboten.
In der Schweiz wird das schweizerische Oberdeutsch vor allem für Schriftausdrücke benutzt und deshalb oft als "Schriftdeutsch" bezeichnet. Der Dialekt hat in den vergangenen Dekaden auf Kosten des (Schweizer) Hochdeutsches zugenommen (obwohl "Hochdeutsch" immer die deutschsprachige Standard-Sprache bedeutet (teilweise mit einem klaren schweizerischen Akzent)):
Hochdeutsch sollte im oralen Unterricht die Amtssprache sein, aber oft beschränkt sich der Unterricht auf allen Ebenen darauf, nur das eigentliche Unterrichtsfach Hochdeutsch zu geben; dazwischen gingen Anmerkungen und Anleitungen wie z.B. Stefan so gut, dass die Fische gehen ("Stefan, sei so gut und schließ das Fenster!") im Dialekt stattfinden.
So wird das Hohe Deutsche zur Fernsprache ("Sprache des Geistes"), der Mundart zur sprachlichen Form der Annäherung ("Sprache des Herzens"). Zunehmend werden auch zwischengeschaltete Fragen und vergleichbare Eingriffe von Schülerinnen und Schüler und Studierenden im Mundart durchgeführt. Besonders in den Privatradios und Fernsehsendern wird fast nur Mundart geredet. Doch da viele Angestellte es gewöhnt sind, ihre gesprochenen Texte in hochdeutscher Schrift aufzuschreiben, führt das Lesen oft zu einer hochdeutschsprachigen Aussprache mit den Klangformen des Dialektes, aber der syntaktischen Ausdrucksweise und dem Vokabular des Hochdeutschen:
Der Hörfunk (Privatsender und schweizerisches Radio) sendet nahezu ausschließlich News und politisches Informationsmaterial (z.B. über den Sender der Zeit) sowie das komplette Kulturkanalprogramm (Radio SRF 2 Kultur) in hochdeutscher Sprache. Beim Privatfernsehen und im schweizerischen Rundfunk (SRF) ist Mundart in Unterhaltungssendungen, Seifenoper und Serie (Hochdeutsch und deutschsprachige Serie werden nicht auf Deutsch synchronisiert), in Kinderprogrammen, in allen Programmen mit ausgeprägtem Bezug zur Schweiz (Volksmusik, regionale Nachrichten), bei der Analyse von Sportprogrammen, in allen Gesprächen und Gesprächen mit deutschsprachigen Schweizern ausserhalb der Hauptbotschaften gebräuchlich.
Im Gemeinde- und Kantonsparlament ist es in der Regel gebräuchlich, im Mundart abzustimmen. In der Schweiz hingegen wird aus Rücksichtnahme auf das Französische, Italienische und Bündner Romanische das (!) Hohe Deutsch geredet. Selbst im schriftlichen Gebrauch ist der Oberdeutsche auf dem Weg des Rückzugs, wenn es um die Intimsphäre geht: Seit dem Ersten Weltkrieg gilt die deutsche Sprache nicht mehr als ausländisch.
Auf der anderen Seite hört sich das schweizerische Oberdeutsch auch für viele Schweizerinnen und Schweizer umständlich an. Zudem haben historische Begebenheiten zu Vorbehalten und Vorurteilen gegenüber den Germanen und Österreicherinnen geführt und damit oft zu einer Ablehnung des Hochdeutschen. Die Dialekt-Sprache wird daher auch gezielt als Demarkation verwendet, obwohl sie nach einer Eingewöhnungsphase des Hörens auch von anderen Deutsch sprechenden Personen ausserhalb der Schweiz gut verstanden wird.
Als Folge dieser Entwicklung driftet die passive und aktive Sprachenkompetenz der Schweiz in der Hochsprache zunehmend auseinander. Zugleich wird Schweizerdeutsch zunehmend im Hochdeutsch ausgesprochen. Der Swiss Idioticon ist das Lexikon der schweizerisch-deutschen Sprachen und zeichnet den lebendigen und geschichtsträchtigen schweizerisch-deutschen Sprachgebrauch (einschließlich der norditalienischen Walsergebiete) auf, nicht aber den bayerischen Dialekt von Samnaun, der im Lexikon der bayerischen Dialekte in Österreich dargestellt wird.
Im Atlas der Deutschschweiz (SDS) werden die Alemannen-Dialekte der Schweiz, darunter auch die Walser-Dialekte Norditaliens, nach der dialektgeografischen Methodik aufgenommen und archiviert. Der " Kleine Sprachenatlas der Deutschschweiz " ist 2010 eine volkswissenschaftliche Kurzfassung des Sprachenatlas. - Unter der Federführung von Elvira Glaser wird zurzeit an der Uni Zürich der "Syntaxatlas der Deutschschweiz " (SADS) entwickelt, der sich mit der im SDS weitestgehend weggelassenen Dialekt-Syntax befasst.
So kann es passieren, dass die Deutschen denken, dass das von den Schweizerinnen und Schweizer mit ihrem Dialekt ausgesprochene Hochdeutsche ist. Weiterführende Informationen finden Sie in den Beiträgen zu den jeweiligen Mundarten und Mundarten. Lexikon der schweizerisch-deutschen Landessprache. Albert Bachmann (Hrsg.): Beitrag zur schweizerisch-deutschen Zeitschrift. Bd. 1-20. Huber, Fraunhofer 1910-1941. (Loud teachings and, for the most part, formal teachings of the dialects of Appenzell, Bernese seeland, Bündner Herrschaft, Entlebuch, Glarus, Jaun, Kaiserslautern, Muten, Obersachsen, Gaffhausen, Sensebezirk, Saint-Wil)
Albert Bachmann: Sprache und Dialekt. Im: Geografisches Wörterbuch der Schweiz. Bd. 4 Attinger Brüder, Neuchâtel 1908, S. 58-76 Manfred Gsteiger, Peter Ott, Andres Kristol, Federico Spiess, Felix Giger: Mundart. Im: Geschichtswörterbuch der Schweiz. Rudolph Hotzenköcherle (Hrsg.): Beitrag zur deutsch-schweizerischen Dialektforschung. Die Deutschschweiz: Peter von Matt.
Über die Schweizer Literaturen und Politiker. Der Carl Hanser-Verlag, München, 2012, ISBN 978-3-446-23880-0, S. 127-138 Peter Ott: Deutschschweiz (im Beitrag Dialekte). Im: Geschichtswörterbuch der Schweiz. Huber, 1962 (Beiträge zur deutsch-schweizerischen Dialektforschung VIII). Sonderegger: Perspektiven einer Deutschschweizer Sprachengeschichte. Eine Anleitung zur deutschsprachigen Wissenschaftsgeschichte.
Elvis Glaser: Ist Schweizerdeutsch eine eigene Landessprache? Zurückgeholt, per Telefon, per E-Mail oder Fax: Retrieved by T. A. S., Seite 27, 2013. de.