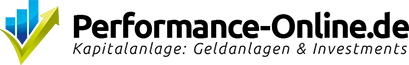Mit Indexfonds können Anleger ihr Geld mit breiter Streuung in Aktien anlegen. Das Prinzip ist ganz …
Containerschiff
Behälterschiffmw-headline" id="Geschichte">Geschichte[Edit | | | Quellcode bearbeiten]>
Für die Containerschifffahrt im Feederverkehr s. Feeder Schiff. Das Containerschiff ist ein für den ISO-Containertransport konzipierter Typ. Das Ladevolumen von Container-Schiffen wird in TEU (Twenty-foot Equivalent Units, s. Tonnage) ausgedrückt und korrespondiert mit der Zahl der 20-Fuß-Container, die beladen werden können. Bei einer Frachtkapazität von bis zu 3400 TEU verfügen einige Frachtschiffe über eigenes Ladegeschirr,[1] bei Schiffen mit höherer Frachtkapazität sind in der Regel Spezialcontainerbrücken an Containerterminals erforderlich, die im entsprechenden Seehafen vorhanden sein müssen.
Der Trend zu immer grösseren Container-Schiffen führt zu einer zunehmenden Bündelung möglicher Anlaufstellen für Container-Schiffe in verhältnismässig wenigen zentralen Containerschiffhäfen, über die ein grosser Teil des Schiffsverkehrs abgewickelt wird[2]. Aus diesen werden Drehscheiben; von und zu ihnen verkehren kleine Container-Schiffe, z.B. Feeder-Schiffe (siehe auch Umschlagproblem - ein Problem der Optimierung im Logistikbereich).
Das Containerschiff der ersten Schiffsgeneration wurde in den 1950er Jahren in den USA gebaut. Nachdem 1955 der Klifford J. Rogers mit sehr kleinen Behältern in Fahrt kam, erfolgte 1956 der Umbau des Tankers Ideale X der Spedition Malcolm McLean. Bereits in der ersten Jahreshälfte der 1960er Jahre wurden Schiffsneubauten als Halbcontainerschiffe geplant, wie etwa Tobias Mærsk, der 1963 in Fahrt kam. 1964 wurden die ersten geplanten Schiffsneubauten als Vollcontainerschiffe für ISO-Container in Australien, die Cooringa, in Auftrag gegeben.
13 ] 1969 wurde der Liniendienst Europa-Australien/Neuseeland auf Container verkehr umgestellt, Ende 1971 Europa-Fernost, im Mai 1977 Europa-Südafrika und Europa-Karibik/Golf von Mexiko. 1981 folgten die Routen Südafrika-Fernost (Safari-Service). Die Umrüstung der wesentlichen planmäßigen Verbindungen auf den Containertransport ist damit vollzogen. Die Containerabmessungen sind 20 oder 40 ft. Die von Sea Landt eingeführten alten 35-Fuß-Containergrößen wurden abgeschafft; heute werden zunehmend 40-Fuß- und 45-Fuß-High-Cube-Container eingesetzt und 53-Fuß-Container innerhalb der USA, da dort größere Lkw zugelassen sind als in Europa.
Die Containerschifffahrt ist in mehrere Generationsstufen unterteilt. Bei den Containerschiffen, die 1968 gebaut wurden, war die Grösse die Masseinheit für ein Fahrzeug der ersten Gen. Zu Beginn des Jahres 1969 tauchte die Begegnungsbucht auf, das erste Kreuzfahrtschiff der zweiten Schiffsgeneration, die nahezu alle eine Maximalbreite von 30,5 Metern haben, d.h. es können bis zu zwölf Behälter neben einander an Bord verstaut werden.
Die maximalen Dimensionen von Container-Schiffen waren lange Zeit 275 lfm und 32,3 lfm breit, so dass sie den Panama-Kanal passieren konnten. Früher wurden Boote dieser Größenordnung als dritte Schiffsgeneration bezeichne. Der Begriff Panamax wird seit etwa 1988 für Boote verwendet, die auch die Maximallänge der Panamakanalschleuse (294 Meter) haben.
Bei den ersten Containerschiffen mit einer Breite von mehr als 32,3 Metern (Panamakanalschleusen) handelt es sich um die fünf Boote der President Truman-Klasse von American President Lines (USA). Es können bis zu 15 Behälter neben einander an Bord verstaut werden. Es hatte eine Gesamtkapazität von 4410 TEU und war das erste Post-Panamax Schiff im Europa-Fernost-Dienst. Hier konnten ebenfalls 15 Behälter mit einer Breite von 38,0 Metern direkt neben einander an Bord gestellt werden.
In den Jahren 1994/1995 folgte die Nedlloyd Hong Kong und Nedlloyd Honshu als erste und bisher einziger offener Post-Panamax-Schiffe für Royal Nedlloyd. Von Japan aus kamen ab Mitte 1994 drei Boote der NYK Altair-Klasse für die NYK Line, fünf identische Boote für Mitsui O.S.K. Lines und die Klasse OOCL-California der Schifffahrtsgesellschaft OOCL (Hong Kong), die zum ersten Mal 16 Behälter auf 40 Meter Höhe Seite an Seite an Bord verstauen konnten.
Die erste Serie von Very Large Container Containerschiffen (VLCS) wurde 1996 mit dem Typ Regina Mærsk in Dienst gestellt. Das waren die ersten 42,8 m breit (sie können 17 Reihen Container Seite an Seite stauen) und die ersten über 300 m lange Container. Bei einer Slotkapazität von 7000 TEU waren die Boote um 50% grösser als die vorherigen Rekordmeister - einen solchen Sprung hatte es noch nie zuvor gegeben. 4.
Seit etwa 1996 gibt es für den so genannten Suezmax-Containerschiffstyp für bis zu vierzehntausend TEU Projekt- und Bauprojekte von Klassifikationsgesellschaften und/oder Werften, seit dem Bau des Suez Kanals können aber auch grössere Schiffstypen wie die Emma Mærsk-Klasse durch den Suez-Kanal fahren. Die Beschränkungen der Umschlagkapazität und der Tiefgang in den Containern wurden jedoch nicht berücksichtigt.
Sehr lange Zeit blieb die German Hapag-Lloyd AG exklusiv dem Panamax-Schiffstyp treu und startete 2001 als letztes der großen Containerreedereien mit dem Bau ihres ersten Post-Panamax-Schiffes, der Hamburg Express. Mit der Emma Mærsk-Klasse baute die Odense-Werft ab Mitte 2006 ein sehr großes Containerschiff mit einer Nutzlast von 14.770 TEU.
Trotz seiner Grösse kommt er mit einem Propeller aus; er wird von einem 14-Zylinder-RT-flex 96 C-B Zweitaktmotor mit weit über 80 Megawatt Motorleistung antreibt . Auf den acht Schiffen der Klasse Emma-Mærsk, die alle mit "E" beginnen, können 22 Behälter in 56,4 Meter Arbeitsbreite Seite an Seite verladen werden. Im Schiffsrumpf werden bis zu elf Containerschichten aufeinander gestapelt, wobei sich höchstens neun Schichten an Bord befinden[16].
Mit der japanischen Schifffahrtsgesellschaft Mitsui O.S.K. Lines wurden anfangs MÃ? 23] Nach Ansicht von Schiffsexperten ist dies das "End of the Line"[24], andere Fachleute gehen von Schiffen mit einer Kapazität von über 23.000 TEU in einigen Jahren aus. Zudem ist das ökonomische Wagnis groß, denn die grössten Boote zahlen sich erst aus, wenn sie wirklich ausgelastet sind.
Die Grösse jedes Containerschiffs ist in TEU -Speicherkapazität angezeigt. Mærsk gibt nun auch die Grösse seiner Containerfahrzeuge in maximaler TEU an. Bei Containerschiffen mit mehr als 50 Reefer-Containern spricht man oft auch von Reefer-Containerschiffen. Zu diesem Zweck werden auch schiffslose Boote verwendet, um die Behälter per Ladekran auszuliefern.
Erste lukenlose Kühlschiffe wurden 1999 von HDW gebaut und bieten Platz für 990 TEU Kühlcontainer und 33 TEU ungekühlt. Sie sind für Dole im Dienst und dienen dem Obsttransport von Mittelamerika in die USA. Die Hamburg Süd ist heute eine der großen Schifffahrtsgesellschaften, die sich auf den Kühlcontainertransport von und nach Südamerika spezialisieren.
Bei den Containerschiffen der "Monte"-Klasse mit 5500 TEU und der "Rio"-Klasse mit 5905 TEU handelt es sich um die Container mit der höchsten Abkühlkapazität. Bereits seit 1990 werden lukenlose Containerfahrzeuge gefertigt. Es handelt sich um Frachtschiffe ohne Luke (oder die bisher einzig großen Frachtschiffe dieser Bauart, die Nedlloyd, später Royal P&O Nedlloyd NV, jetzt Mærsk mit den fünf Panamax Ultimate Container Carrier Schiffen, die 1991/1992 erbaut wurden, und die beiden ersten Postpanamax Open-Top-Flugzeuge der Welt, Nedlloyd Hong Kong und Nedlloyd Hongshu, die 1994 erbaut wurden. Bei den Containerschiffen der ersten und zweiten Schiffsgeneration wurde ein Einschneckenantrieb (Dampfturbine oder Dieselmotor) eingesetzt.
Bei den Schiffen der dritten Schiffsgeneration (Baujahr 1971-1981) waren zunächst 27-28 kn zu erwarten. Eine weitere Konzeption, die erstmalig in dieser Containerschiffsgeneration realisiert wurde, waren die Gasturbinenschiffen vom Typ Euroliner. Aufgrund der gestiegenen Erdölpreise und des Verzichtes auf die sehr schnelle Fahrt von 28 kn wurden seit Ende der 70er Jahre nahezu alle turbinengetriebenen Containerboote auf Dieselmotoren umgerüstet, da sie deutlich weniger Kraftstoffverbrauch haben.
Der übliche Einsatz von nahezu allen großen Containerschiffen betrug 24 kn, Ende der 2000er Jahre etwa 25 kn. Von der Volkswerft Stralsund im Mai 2006 ausgeliefert, ist die Mærsk Boston das weltweit schnellste Containerschiff mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 29,2 kn mit einem 12-Zylinder Sulzer-Dieselmotor.
Mærsk Boston hat die folgende Daten: Großcontainerschiffe mit über 7000 TEU werden auf den nachfolgenden Schiffswerften gebaut: Im Anfangsstadium der Containerschifffahrt von 1968 bis 1977 wurde eine beachtliche Anzahl von Großcontainerschiffen der ersten bis dritten Klasse gefertigt.
Sie wurde von der zweiten Werftengeneration Deutschlands errichtet, die damals in dieser Branche Vorreiter waren: Die Firma wurde in der zweiten Hälfte des 20: Das bis dato größte Containerschiff (5 Schiffe) hat eine Tragfähigkeit von 5468 TEU und wurde 1999/2000 von den Firmen Acer MTW, Wismar und Akademie der Künste Warnowwerft, Warnmünde, an P&O Nedlloyd abgeliefert. Auf der Volkswerft Stralsund, Stralsund, wurden ab Oktober 2005 die grössten aktuell auf einer Schiffswerft produzierten Containerboote gefertigt.
Der Schiffstyp, die Mærsk Boston, wurde am Tag der Taufe am Tag des Erscheinens am Tag der Taufe im Jahr 2006 übergeben. Diese sind vom Type VWS4000 und messen 294,1 Meter lang und 32,18 Meter breit mit einer Tragfähigkeit von 4250 TEU. Mit einer Servicegeschwindigkeit von 29,2 kn sind sie die weltweit am schnellsten fahrenden Container-Schiffe.
Container-Schiffe ships of size 2500/2700 TEU (type CV 2500/2700) built HDW in Kiel, SSW in Bremerhaven, Northseewerke in Emden, Blohm + Voss in Hamburg, Volkswerft in Stralsund, Acer Werften in Wismar and Warnemünde. Die Hamburger Schiffswerft J. J. Sietas ist seit Jahren ein führender Hersteller von Container-Schiffen bis zu einer Größenordnung von 1200 TEU (Feederschiffe).
Diese Schiffswerft hat seit Beginn des Jahres 2006 auch grössere Container-Schiffe gebaut, das erste 1700 TEU Schiff wurde mit der safmarinen Bashe abtransportiert. In der Zwischenzeit wurde dort der Containerschiffbau gestoppt. Hapag-Lloyd AG, von 1976 bis 1983 immer noch die grösste Containerreederei der Erde, gehörte lange Zeit nicht zu den "Top 10" im Ranking.
Damit rückt Hapag-Lloyd auf den 6. Rang unter den großen Containerreedereien vor. Es wurde am Freitag, den 12. März 2005, bekannt gegeben, dass das Unternehmen P&O Nedlloyd für 2,96 Mrd. US-Dollar (2,3 Mrd. Euro) erwerben wird. P&O Nedlloyd gibt es seit Januar 2006 nicht mehr. Es wurde voll in die "Mærsk-Linie" miteinbezogen.
Mit der Akquisition steigerte der Weltmarktführer Mærsk seinen Anteil am weltweiten Containerverkehrsmarkt von 12 auf 18%. Im Jahr 1969 wurde der Liniendienst auf der Strecke Europa-Australien/Neuseeland auf den Containertransport mit der zweiten Schiffsgeneration (ANZECS-Dienst) umgestellt. Sie wurde von Hapag-Lloyd, Deutschland, Overseas Containers Limited (OCL), Großbritannien (ein Verband von fünf großen britischen Linienreedereien), Associated Containertransport ( "ACT"), Großbritannien, Nedlloyd, Niederlande, Australian National Line und New Zealand Shipping Company ins Leben gerufen.
Im Jahr 1968 entschieden sich die großen Linienreeder, auf den Containertransport umzusteigen. Damals bedeutet die Verlagerung auf den Containertransport ein so großes Volumen, dass keine Schifffahrtsgesellschaft es allein bezahlen konnte oder wollte. Hier wurden zwischen 11. und 17. November 1971 die damals grössten und raschesten Container-Schiffe der dritten Generation in Dienst gestellt.
Die TRIO wurde von den Schifffahrtsgesellschaften NYK Line/Japan (3, ab 1976 4 Schiffe), Mitsui O.S.K. Lines/Japan (2, ab 1977 3 Schiffe), Hapag-Lloyd/Deutschland (4, ab 1981 5 Schiffe), Overseas Container Line (OCL)/Großbritannien (5, ab 1989 7 Fahrzeuge; wurde später von P&O übernommen) und Ben Line-Ellerman/Großbritannien (3 Schiffe). Die TRIO wurde zu Beginn des Jahres 1991 eingestellt, aber die Hapag-Lloyd AG und die NYK Line arbeiten weiter mit anderen Schifffahrtsgesellschaften zusammen.
Das dritte Bündnis wurde 1975 mit dem ACE-Dienst ( "Asian Container Europe") der Reederei K-Line/Japan, der Reederei OOCL/Hong Kong, der Neptune Oranje Lines (NOL)/Singapur und der Compagnie Marine Belgiën (CMB)/Belgien geschlossen. Zwischen 1991 und 1996 gab es eine Kooperation zwischen Mærsk Line und P&O. Ab 1996 kooperierte der Weltmarktführer Mærsk Line jedoch weltweit mit der American Sea Land Corp.
Der Zuwachs war so vorteilhaft, dass Mærsk 1999 die US-Reederei nahezu vollständig übernahm. Im Jahr 1991 starteten die drei nordischen Schifffahrtsgesellschaften sowie Ben Line und Ellermann den BEN-EAC-Service. In den Jahren 1996 bis 2001 gab es die Global Allianz der Schifffahrtsgesellschaften Hapag-Lloyd AG, NYK Line, NOL und N&O. Nach dem Zusammenschluss mit P&O im Jahr 1997 kam Royal Nedlloyd dazu.
Im Jahr 1977 startete der Containertransport auf der Strecke Europa-Südafrika, dem so genannten SAECS-Service, der von den Reedern der Deutschen Afrika Linien (Hamburg), Compagnie Maritime Belge, Royal Nedlloyd, Overseas Container Line (später P&O) und Safmarine, Südafrika, ins Leben gerufen wurde. Mærsk Line, Safmarine, CGM (nur bis Ende der 90er Jahre) und die Deutschen Afrika Line, seit 2006 auch Mitsui Osk Lines.
Die Containerseeschifffahrt: Thomas Pawlik, Heinrich Hecht. Der Heel-Verlag 2007, ISBN 978-3-89880 873-6 Hans Jürgen Witthöft: Container - Die Mega-Carrier kommen. Vorläufig die letzten Container-Schiffe der Werft in Deutschland. Ort: Hansa, Ausgabe 7/2011, Schiffahrts-Verlag Hansa, Hamburg 2011, ISSN 0017-7504, S. 24-27- Auf über 5100 Containerschiffen angewachsen. Im: Tagesbericht vom 28. April 2013, S. 1 Ralf Witthohn: Kapazitäten nähern sich 20.000 TEU.
Zu: Hansa, Ausgabe 2/2017, S. 30. mit Containerschiff. Das Frachtschiff der Samsung-Werft in Südkorea, am 26. Januar 2005 OOCL Atlanta genannt, wurde für die Containerlinie des Orients in neun Monate von mehr als 8000 Mitarbeitern erbaut. Der Containerschiff hat eine Gesamtlänge von 323 Meter und eine Schiffsbreite von über 40 Meter und kostet 150 Mio. Dollars.
? Hartmann-Reederei: Prinzip des Containerschiffes (Memento des Original vom 11. Januar 2015 im Internetarchiv) Info: Der Archiv-Link wurde automatisiert verwendet und noch nicht überprüft. ? Bruno Bock: Schiff des Jahrgangs 1970/71 in: Schifffahrtsjahrbuch, Bd. 10, Hestra-Verlag, Darmstadt 1971, S. 171. Bruno Bock: Schifffahrt des Jahres 1971/72. In: Schifffahrtsjahrbuch, Bd. 11, Hestra-Verlag, Darmstadt 1972. ? Maersk macht einen gewaltigen Größensprung.
MOL ordert sechs Fahrzeuge mit einer Gesamtkapazität von je rund 200.000 TEU. de, Stand 31. Februar 2015, Zugang am 9. Februar 2015. Laut Geschäftsbericht S. 31 275 Fahrzeuge mit ca. 1,6 Millionen TEU im Eigenbesitz und 295 Fahrzeuge mit ca. 1 Million TEU Charter.