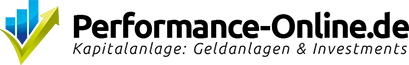Wenn von sicheren Geldanlagen die Rede ist, werden neben Festgeld und Tagesgeld auch immer …
Vermögen
Reichtummw-headline" id= "Allgemeines" id="Allgemeines" id="Allgemeines >[Editieren | | | Quellcode bearbeiten]>
Ökonomisch gesehen sind Vermögenswerte der monetäre Gegenwert aller materieller und immaterieller Vermögenswerte, die einer wirtschaftlichen Einheit gehören. Der Begriff der Immobilie ist abhängig von der Zweckmäßigkeit der Person, die die Immobilie für einen bestimmten Zweck prüfen möchte. 1] Für ökonomische Ziele ist es in jedem Fall notwendig, dass der Vermögensgegenstand objektiv bewertet werden kann und dass die wirtschaftlich Berechtigte über ihr Vermögen verfügt, ohne dass es notwendig ist, ob das Vermögen auch Einnahmen generiert.
Wurden von der wirtschaftlichen Einheit Anteile ihrer Vermögenswerte als Sicherheit an den Sicherheitennehmer abgetreten, darf sie diese nicht veräußern (nur nutzen); ein als Sicherheit übertragenes Vehikel ist jedoch Eigentum des Sicherungsgebers, der das Vehikel gegebenenfalls gar als Sachanlage bilanziert (§ 246 Abs. 1 HGB). Obwohl es keine Einkünfte aus dem Verkauf von Eigentum oder Grundstücken gibt, bleibt es im Besitz des Vermögen.
Obgleich es innerhalb des staatlichen Vermögens (in lateinischer Sprache: resp. des lateinischen Wortes extras commercium) unveräußerliches Verwaltungsgut gibt, das direkt der Wahrnehmung öffentlicher Aufträge und Zwecke dienen soll, ist es Teil des staatlichen Vermögens. Nicht-Teil des Eigentums ist das, was nicht dem Vermögensinhaber zusteht, d.h. alle Gegenstände, die sich nur in seinem Besitztum befinden (geliehene, vermietete, verpachtete, geleaste, verpachtete, geraubte oder vorgefundene Gegenstände).
Abhängig davon, welche wirtschaftliche Einheit das Vermögen als Inhaber oder Rechteinhaber hat, kann man zwischen privatem Vermögen (private Haushalte), betriebsnotwendigem Vermögen (Unternehmen), kirchlichem Vermögen (Kirche) oder staatlichem Vermögen (Staat und seine Gliederungen wie z. B. Öffentliche Hand, staatliche Betriebe oder kommunale Unternehmen) differenzieren. Alle sind Teil des Gesamtvermögens als Gesamtheit aller Nettovermögenswerte einer Wirtschaft.
"Das Vermögen des Staatenbundes umfasst im Prinzip die gesamten Sach- und Geldvermögen des Staatenbundes, einschliesslich der Rechte und Ansprüche....". 2] Die Aktien der einzelnen Wirtschaftssubjekte am gesamten Vermögen werden als persönliche Vermögensallokation bezeichnet. Das Geschäftsvermögen umfasst neben den reinen Sachanlagen (z.B. Kassenbestand, Liegenschaften, Anlagen und Maschinen) auch den Äquivalenzwert des immateriellen Vermögens (z.B. Patent rechte, Lizenzrechte oder Markennamen).
In der Regel bilden die Vermögenswerte eine Vermögensgruppe, da sie aus verschiedenen Vermögenswerten bestehen, die durch einen einheitlichen ökonomischen Verwendungszweck verknüpft sind und ihren ökonomischen Nutzen nur als Ganzes entwickeln können. Vermögenswerte sind eine Bestandszahl und werden durch Verkauf, Entwendung, Abschreibung oder Aufwendung reduziert und durch Erwerb, Spende, Erbschaft, Kapitalzuwachs oder wertsteigernde Einkünfte anwachsen.
Der Begriff "Reichtum" existierte im Hochmittelalter lange Zeit nicht, nur das Wort "können" im Sinn von "können". 5 ] Ein oberösterreichisches Sprichwort von 1539 zeigt zum ersten Mal, dass "jeder Hamburger.... sein Vermögen... jedes Jahr auf eidesstattliche Hilfe besteuern soll".
6 ] Dies ist auch der erste Verweis auf die Vermögenssteuer. Das Vermögen hat sich im Laufe des Mittelalters als Vermögen bei Prinzen, Herrschern oder Könige angesammelt; damals nannte man es Kameralgut. Die Staatsdomäne hingegen war das Eigentum des Staates. Jh. erschien das große Geschäft erstmals außerhalb der nationalen Herrscher in Deutschland ("Fugger") und Italien ("Medici").
Seit den Anfängen der Selbständigkeit Jakob Fuggers (von etwa 1487 bis 1511) soll sich das Vermögen der Fuggers etwa vervielfacht haben. 7 ]Anna Maria Luisa de' Medici war die Letzten, die 1723 den großen Reichtum der Menschheit in den vergangenen Jahren erbte.
8] Auch die Patriziers und einige Langobarden wurden als reich angesehen. 1610 verfügte die Schweiz, dass jeder, der die lokale Staatsbürgerschaft erwerben wollte, 1000 reine Eigentumsgulden hat. 9] 1733 wurde das Eigenkapital als Eigentum des Händlers angesehen: "Kapital ist Eigentum eines Händlers....". 10] Das Generalpreußische Grundgesetz (APL) vom 1794 war mit "verkehrsfähigem Vermögen" (I 2, § 11 APL) oder "beweglichem Vermögen" (I 2, § 10 APL) vertraut.
Im Jahre 1840 waren für Carl von Savigny "die Forderungen als Bestandteil des Eigentums zu betrachten",[11] die dann das Eigentum als "die dem Eigentümer nach Abzugsfähigkeit der Forderungen verbleibende Rechtssumme" definierten. 12] Seitdem enthält die gesetzliche Definition von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, während das so genannten "natürliche Vermögen" nur noch Vermögenswerte einbezieht.
Mit dem HGB vom Jänner 1900 wurden die Bezeichnungen Sachanlagevermögen (mit den Unterkonzepten immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen und Finanzanlagen) und kurzfristiges Vermögen ( 266 HGB) für Gesellschaften eingeführt. Die Einstufung erfolgte in Anlehnung an die allgemeine ökonomische Klassifizierung der Assetklassen. Je nachdem, ob der Schwerpunkt auf Sach- oder geldnahen Vermögenswerten liegt, wird eine grobe Unterscheidung zwischen Sach- und Finanzanlagevermögen getroffen:
1957 kam Milton Friedman mit Humankapital in Form von menschlichem Wissen und Qualifikation hinzu. Gemäß 1085 BGB ist auch die Nießbrauchbarkeit von Vermögensgegenständen möglich, jedoch nur an den zu den Vermögensgegenständen gehöre. Er gibt die Verzinsung eines bestimmten Vermögenswertes an.
Mit diesen Kennziffern kann der Vermögensinhaber, seine Gläubiger, die Analysten oder die interessierte Bevölkerung die wirtschaftliche Situation einer wirtschaftlich tätigen Einheit beurteilen. Größere Vermögenswerte sind als Portfolios zu betrachten, deren Zusammenstellung einer Risikostreuung durch Portfolioverwaltung oder Asset Management unterliegt. Markt-, Zins- oder Preisrisiken können Auswirkungen auf den Vermögensgegenstand haben und zu einer Wertminderung oder einem Wertverlust des Vermögensgegenstandes beitragen.
Auf diese Weise kann das unstrukturierte Vermögensrisiko gestreut werden, während dem Systemrisiko nur durch Hedging gegengesteuert wird. In vielen Ländern unterliegt das Vermögen einer Vermögenssteuer, die in Deutschland seit Jänner 1997 nicht mehr als Vermögenssteuer gilt. Wenn diese Steuern nicht durch die Kapitalrendite erwirtschaftet werden, entsteht ein Vermögensschaden.
Eine Vermögenssteuer kann dazu fuehren, dass inlaendische Guthaben ins Ausland transferiert und dann als Auslandsguthaben bezeichnet werden. In den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) wird das nationale Vermögen in der Vermögensübersicht als die Gesamtheit aller Nettovermögenswerte innerhalb einer Wirtschaft bezeichnet. Aktiven, Debitoren und Kreditoren sind im Anlagenkonto enthalten.
Im Europäischen Rechnungsführungssystem (ESVG) werden Vermögenswerte, Schulden (Vermögenswerte und Forderungen) mit Schulden bei der Erstellung von Bilanzen verglichen. Bei den Finanzbilanzen werden die Außenstände den Schulden gegenüberstellt. Die Finanzbilanzen werden von der Deutsche Bank erstellt und publiziert. Das Vermögen besteht aus den hergestellten und nicht hergestellten Vermögensgegenständen.
Das produzierte Vermögen besteht aus Sachanlagen und Vorräte und Wertgegenständen. Nicht produzierte Aktiva umfassen nicht produzierte Sachanlagen wie Grundstücke, natürliche Ressourcen, frei verfügbare Tier- und Pflanzenbestände und Wasservorräte sowie nicht produzierte nicht produzierte Aktiva wie z. B. Patentrechte, Gebrauchsrechte, aktivierte Geschäfts- oder Firmenwerte und andere nicht produzierte Aktiva. Bei der Asset Allocation werden die Assets unterschiedlicher Unternehmensteile oder Unternehmensgruppen miteinander verglichen.
Die Privatvermögensbildung ist eine Altersvorsorgealternative und wird von einigen Ländern unterstützt (siehe auch: Mitarbeitersparzulage, Wohnbauprämie, Altersvorsorgezulage). Thomas Druyen/Wolfgang Lauterbach/Matthias Gründmann (Hrsg.), Vermögen, 2009, S. 14 f.