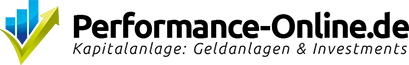Mit Indexfonds können Anleger ihr Geld mit breiter Streuung in Aktien anlegen. Das Prinzip ist ganz …
Kapitalerhöhung
Aufstockung des KapitalsArten der Kapitalbeschaffung
Wenn die AG Eigenkapital braucht, kann sie sich in der Regel für Folgendes entscheiden: Die Kapitalerhöhungen der AG können auf 3 Wegen durchgeführt werden: Alle 3 Kapitalerhöhungen haben gemeinsam: die Durchführung durch Eintragung in das Handelsregister. Bedingtes Aktienkapital. Bei der Bezugsrechtskapitalerhöhung handelt es sich um das Recht zum Bezug von neuen ausgegebenen Anteilen ( "Bezugsrecht") (vgl. OR 653b Abs. 1).
Die Bezugsrechte können unter bestimmten Bedingungen eingeschränkt werden (siehe OR 704 Abs. 1 Ziff. 6; OR 653b Abs. 2). Das Grundkapital wird beschlossen, wenn feststeht, zu welchem Kurs die Anteile emittiert werden und wer sie zeichnen wird. Der genehmigte Kapitalerhöhungsbeschluss betrifft im Unterschied zur Kapitalerhöhung nicht die Gesellschaft.
Das Verfahren sieht daher wie folgt aus: Die Kapitalerhöhung ist das Mittel zur nachträglichen Wandlung von Fremdkapital in Kapital bei Wandel- und Optionsschuldverschreibungen. Deutlich von der normalen Kapitalerhöhung abweichende Prozesse sind: fürstmoser peter, Zulassung des Zeichnungsverfahrens für gesellschaftsrechtliche Kapitalerhöhung, in: SZW 65 (1993), S. 101 ff.
Und wie geht das? Ausstattungsmerkmale ("Typen & Besonderheiten")
Durch eine Kapitalerhöhung können Firmen ihr Grundkapital aufstocken. Eigenkapitalerhöhungen bringen den Aktionären einen Vorteil, da sie ihre Aktien zum einen durch das Aktienbezugsrecht besitzen können und zum anderen der Kurs der Aktie durch die Kapitalerhöhung nachgeben kann. Einige Gesellschaften verbieten auch das Zeichnungsrecht, so dass die Aktien der Anteilseigner nach der Kapitalerhöhung weniger werthaltig sind und sie ein geringeres Wahlrecht haben.
Bei der Kapitalerhöhung für Kapitalgesellschaften ist die Kapitalerhöhung durch Emission von neuen Anteilen enthalten. Die Kapitalerhöhung ist in der Regel für Investoren von Bedeutung, da sie sich sowohl auf die stimmberechtigten Anteile als auch auf die Dividenden und den Aktienwert auswirkt. GmbHs und Gesellschaften anderer Rechtsform können auch eine Kapitalerhöhung durchführt werden. Es gibt viele Ursachen für eine Kapitalerhöhung: Das Geschäft muss neu finanziert werden, weil es eine Akquisition geplant hat oder für Beteiligungen aufzubringen ist.
Die Firma hat Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Gesellschaft konzentriert sich auf den Wachstumskurs und strebt eine breite Investorenbasis durch die Emission von neuen Anteilen an. Im Falle einer Kapitalerhöhung gibt die Gesellschaft neue Anteile aus. Dabei werden die neuen Anteile in einem festgelegten Verhältnis zu den bisherigen Stückaktien ausgeben. Beispielsweise bekommen die bisherigen Aktionäre bei einem Verhältnis von 1:3 drei neue Anteile für eine alte Aktie, die sie haben.
Der Bezugsrechtsausgleich dient dazu, dass die bisherigen Aktionäre ihre Stimm- und Dividendenaktien trotz Emission von neuen Anteilen behalten können. Nach einer Kapitalerhöhung müssen Sie jedoch damit rechnen, dass sich Ihr Aktienbesitz verringert und der Kurs Ihrer Aktie "verwässert" wird. Im Falle einer Kapitalerhöhung ist der Hauptgeschäftsführer der Gesellschaft berechtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft über einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren auf bis zu 50 vom Hundert des derzeitigen Aktienkapitals zu steigern.
Der Vorstand wird in den nächsten fünf Jahren keine weitere Genehmigung zur Durchführung der Kapitalerhöhung einholen. Diese Aufstockung kann beispielsweise notwendig sein, um auf Veränderungen am Markt flexibler agieren und neue Anteile ohne Einberufung einer Generalversammlung emittieren zu können. Im Falle einer bedingte Kapitalerhöhung wird die Kapitalerhöhung davon abhängen, dass die Investoren von einem Umtauschangebot Gebrauch machen.
Beispielsweise kann die Kapitalerhöhung durch den Umtausch von Wandelschuldverschreibungen durchgeführt werden. Ein Bezugsrecht der Aktionäre ist bei der Durchführung der Kapitalerhöhung im Regelfall nicht gegeben. Je nach Anzahl der durch den Umtausch von Anleihen entstandenen Anteile kann es daher zu Wertverlusten kommen. Im deutschen Aktienrecht wird grundlegend zwischen zwei unterschiedlichen Kapitalerhöhungsformen für Kapitalgesellschaften unterschieden, der effektiven Kapitalerhöhung und der Nominalkapitalerhöhung.
Im Falle einer wirksamen Kapitalerhöhung kommt es zu einem externen Zufluss. Dadurch bekommt die AG neues Eigenkapital. Bei einer wirksamen Kapitalerhöhung handelt es sich beispielsweise um eine Kapitalerhöhung durch Emission von neuen Anteilen. Auch hier kann die wirksame Kapitalerhöhung in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden: Dabei werden neue Anteile emittiert und den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt.
Damit können Sie neue Anteile in einem gewissen Verhältnis zu den alten Anteilen beziehen. Kapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss: Es besteht auch die Option für Gesellschaften, das Bezugsrecht im Falle einer wirksamen Kapitalerhöhung auszuschließen. Im Rahmen dieses Verfahrens gibt es eine Bezugsfrist, innerhalb derer die neuen Anteile ausgeschrieben werden. Bei dieser Option werden die neuen Anteile als Paket an eine Emissionsbank veräußert.
Der Verkauf der Anteile an die Anleger wird in wenigen Tagen erfolgen. Im Falle einer Nominalkapitalerhöhung wird die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durchgeführt. Es handelt sich um interne Finanzierungen, die kein Fremdkapital erfordern. Beispielsweise können die Gesellschaftsreserven der AG für die Kapitalerhöhung verwendet werden. Die Durchführung der Nominalkapitalerhöhung wird in der Regel durch Herausgabe von "Gratisaktien" durchgeführt.
In diesem Falle werden die Anteilseigner mehr Anteile bekommen, aber der Wert der Anteile wird sich nicht erhöhen. Die Grundkapitalerhöhung ist damit mit einem Aktiensplitt zu vergleichen. Die Nennkapitalerhöhung verspricht den Gesellschaften einen tieferen Aktienkurs und damit eine erhöhte Investorenattraktivität der Anleihen. Das Grundkapital muss eingetragen werden.
Um eine Kapitalerhöhung in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung durchzuführen, muss gemäß 55 GmbH-Gesetz ein so genannter "Erhöhungsbeschluss" bestehen, durch den die entsprechende Gesellschaftssatzung angepasst werden kann. Demzufolge haben die Aktionäre kein gesetzliches Recht auf den Bezug von Aktien bei der Gesellschaft, wie bei den Gesellschaftern, wenn das Stammkapital aufgestockt wird. Stattdessen können die Aktionäre auch nach einer Kapitalerhöhung einen Verlust hinnehmen, weil die Anteile in der Hauptversammlung erneut ausgeschüttet werden.
Übertragung von Neukapital: Bei der Kapitalerhöhung bringen die Aktionäre neue Mittel ein. Rücklagenumwandlung: Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann Reserven in Eigenmittel umwandeln und damit anheben. Weil die Reserven sowieso schon den Aktionären zustehen, gibt es bei dieser Art der Kapitalerhöhung in der Regel keine neue Kapitalausschüttung. Kapitalerhöhungen durch Geschäftsführer: In der Satzung kann festgelegt werden, dass die Geschäftsführung einer Gesellschaft das Stammkapital bis zu einer bestimmten Höhe eigenverantwortlich aufstocken kann.
Die Kapitalerhöhung kann beispielsweise zur Einstellung von neuen Mitarbeitern oder zur Investition in neue Anlagen vonnöten sein. In Abhängigkeit von dem verfolgten Zweck sind hybride Formen der Kapitalerhöhung auch für Gesellschaften mit beschränkter Haftung statthaft. Im Falle von Personenhandelsgesellschaften wie z. B. Personenhandelsgesellschaften (OHG) oder Personenhandelsgesellschaften (KG) kann eine Kapitalerhöhung auf zwei unterschiedliche Weisen erfolgen: Weitere Investitionen bestehender oder neu hinzugekommener Gesellschafter: In diesem Falle einigen sich alle Aktionäre auf Kapitalsubventionen.
Alle Anteilseigner müssen jeder Art von Kapitalerhöhung in einer Partnerschaft zugestimmt haben. Eine Gesellschaft hat die Option, die stillen Beteiligungen zu akzeptieren. Diese Kapitalerhöhungsform ist daher Teil der so genannten "Verbindlichkeiten". Es wird nicht als Eigenmittel angerechnet. Den Aktionären steht grundsätzlich ein so genanntes Bezugsrecht bei einer Kapitalerhöhung gemäß § 186 AktG zu.
Die bisherigen Aktionäre können in diesem Falle zunächst die neuen und die neuen Anteile erwerben. Diese werden ihnen dann von den ausgebenden Gesellschaften entsprechend ihrem Stimmrecht zur Verfügung gestellt. Damit soll vermieden werden, dass das Beteiligungsportfolio durch eine Kapitalerhöhung an Wertverlust und Stimmrechten "verwässert" wird. Die Kapitalerhöhung weicht damit vom Aktiensplitt ab.
Dabei wird die Anzahl der Anteile durch die Aufteilung der bestehenden Anteile vergrößert. Die Stimmrechts- und Gewinnerwartung für die Anteilseigner bleibt daher unverändert, da nur die Anzahl der Anteile steigt oder sinkt, nicht aber deren Gegenwert. Praktisch schränken immer mehr Firmen ihre Bezugsrechte ein. Durch die Beschränkung des Bezugsrechtes können beispielsweise neue Titel rasch emittiert und neue Anteilseigner, die noch nicht in die Gesellschaft investieren, gewonnen werden.
Eine Kapitalerhöhung führt in der Regel zu einem geringeren Kurs, da die Anzahl der zur Verfügung stehenden Anteile an der Gesellschaft zunimmt. Diese Kursverluste werden in der Regel durch eine erhöhte Nachfragesteigerung der neuen Aktie vergleichsweise rasch kompensiert. Gegenüber einer Kapitalerhöhung steht die Kapitalerhöhung. Es kann sowohl bei Kapitalgesellschaften als auch bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung sein.
Als Teil einer Kapitalreduktion wird das Grundkapital einer Gesellschaft reduziert. So wird beispielsweise versucht, einen bilanzierten Verlust zurückzuzahlen. Dies wird auch als "Nennkapitalherabsetzung" bezeichne. Die Reduzierung des Kapitals kann auch zu einer Verteilung des überschüssigen Kapitals an die Aktionäre führen. Dieses Verfahren wird auch als wirksame Kapitalreduktion bezeichne.
Rechtsgrundlage für die Herabsetzung des Grundkapitals von Kapitalgesellschaften ist das deutsche Aktienrecht für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHs). Für GmbHs und Agenten muss die Herabsetzung im Firmenbuch vermerkt werden. Einfache Kapitalherabsetzung: Die erleichterte Herabsetzung ist in den 229 bis 236 des Aktiengesetzes definiert. Er darf daher nur zum Aufrechnen von Wertberichtigungen, zur Abdeckung von sonstigen Verlusten und für die Kapitalrücklage verwendet werden.
Beispielsweise müssen die Gewinnreserven komplett freigegeben werden, damit die erleichterte Kapitalerhöhung durchführbar ist. Herabsetzung des Kapitals durch Einziehung von Aktien: Diese Art der Herabsetzung ist in den 237 bis 249 des Aktiengesetzes genauer geregelt. Dementsprechend kann sie zum Ausgleich von nominalen Verlusten oder zur Rückzahlung von Eigenkapital an Investoren verwendet werden.
Dann werden die Anteile entweder von den Anteilseignern gewaltsam zurückgenommen oder die Anteile werden zurückerworben und einziehen. Kapitalerhöhung bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Eine Kapitalerhöhung bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann stattfinden, wenn eine solche mit Dreiviertelmehrheit auf der Hauptversammlung beschließt. Es ist das Mindestmaß für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.